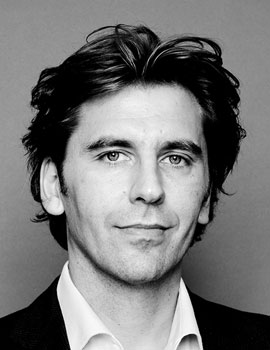Wenn die Zucht zur Qual wird
Bei der Zucht werden die Bedürfnisse von Tieren oftmals ausser Acht gelassen und es stehen vielmehr ästhetische oder emotionale Anforderungen des Menschen im Vordergrund. Insbesondere bei Hunden bleibt kaum eine Rasse von zuchtbedingten Belastungen verschont. Kurzköpfigkeit, überlange oder verkürzte Körperteile und Fellanomalien sind nur einige der Zuchtmerkmale, die bei Hunden (Tieren allgemein) teilweise starke Leiden hervorrufen und daher unter das Verbot der Qualzucht fallen können.
Definition Qualzucht
Unter dem Begriff "Tierzucht" wird die gezielte Verpaarung von Tieren nach bestimmten äusserlichen oder charakterlichen Merkmalen verstanden. Von einer Qualzucht (auch Extrem- oder Defektzucht genannt) wird ausgegangen, wenn aufgrund der angestrebten Zuchtziele damit gerechnet werden muss, dass bei den Elterntieren oder ihren Nachkommen Schmerzen, Leiden, Schäden oder Verhaltensstörungen auftreten. Bestimmte Merkmale werden züchterisch derart verstärkt, dass dies für die Hunde mit erheblichen körperlichen Beeinträchtigungen verbunden sein kann und ihnen das Ausleben grundlegender Bedürfnisse verunmöglicht wird.
Qualzuchtverbot im Tierschutzgesetz

Der Schweizer Gesetzgeber hat im Tierschutzgesetz ein ausdrückliches Qualzuchtverbot verankert. Dieses schreibt vor, dass eine Zucht stets auf den Erhalt gesunder Tiere ausgerichtet sein muss, deren Eigenschaften und Merkmale die Würde der Tiere nicht missachten. Zuchtziele, die eingeschränkte Organ- und Sinnesfunktionen und Abweichungen vom arttypischen Verhalten zur Folge haben, sind nur dann zulässig, wenn sie ohne das Tier belastende Massnahmen bei Pflege, Haltung oder Fütterung, ohne Eingriffe am Tier und ohne regelmässige medizinische
Pflegemassnahmen kompensiert werden können. Das Züchten von Tieren, bei denen damit gerechnet werden muss, dass erblich bedingt Körperteile oder Organe für den arttypischen Gebrauch fehlen oder umgestaltet sind und dem Tier dadurch Schmerzen, Leiden oder Schäden entstehen, ist verboten. Ebenso untersagt ist das Züchten von Tieren mit Abweichungen vom arttypischen Verhalten, die das Zusammenleben mit Artgenossen erheblich erschweren oder verunmöglichen. Zudem dürfen Tiere, die aufgrund unzulässiger Zuchtziele gezüchtet wurden, nicht ausgestellt werden. Eine Qualzucht bedeutet aus rechtlicher Sicht sowohl eine Misshandlung als auch eine Missachtung der Tierwürde und ist damit eine Tierquälerei gemäss Artikel 26 Abs. 1 lit. a Tierschutzgesetz, die mit einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren sanktioniert wird.
Belastungskategorien und Zuchtverbote
Konkretisiert wird das Qualzuchtverbot durch eine spezielle Verordnung des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) über den «Tierschutz beim Züchten». Darin werden die zuchtbedingten Belastungen in vier Kategorien (keine, leichte, mittlere und schwere Belastung) eingeteilt, je nachdem in welcher Dauer und Intensität die Zucht bei den Tieren zu Schmerzen, Leiden, Schäden oder Eingriffen in ihr Erscheinungsbild oder ihre Fähigkeiten führt.
Tiere, die nicht oder nur leicht belastet sind, können weiterhin für die Zucht eingesetzt werden. Das Züchten mit Tieren mit mittlerer Belastung ist hingegen nur erlaubt, wenn das Zuchtziel darin besteht, dass die Belastung der Nachkommen geringer sein soll als jene der Elterntiere. Verboten ist die Zucht mit Tieren, die eine schwere Belastung aufweisen oder vererben. Wer ein Tier mit einem Merkmal oder Symptom zur Zucht einsetzen will, das zu einer mittleren oder starken Belastung (zum Beispiel Skelettdeformationen, Bewegungsanomalien, Schädeldeformationen mit behindernden Auswirkungen, Fehlfunktionen der Augen oder des Hörapparats) führen kann, muss zunächst eine Belastungsbeurteilung durch eine Tierärztin oder eine andere Fachperson vornehmen lassen. Ausdrücklich verboten ist unter anderem die Zucht von sogenannten "Teacup-Hunden" bzw. Zwerghunden, die ausgewachsen weniger als 1500 Gramm wiegen und ihrem Name zufolge theoretisch in eine Teetasse passen würden.
Exzessive Hundezucht
Trotz des klaren Verbots ist das Züchten von Tieren, denen aufgrund extremer Merkmale erhebliche Leiden entstehen, in der Praxis leider alltäglich. Durch die bewusste Verwendung von Zuchtdefekten sind nicht zuletzt bei Hunden neben herkömmlichen Formen auch viele Rassen entstanden, bei denen den genetischen, anatomischen und physiologischen Gesetzmässigkeiten nicht angemessen Rechnung getragen wurde. Das weite Spektrum reicht hier von zwergwüchsigen Tieren (wie Chihuahuas, Yorkshire Terrier, Zwergspitze und -pudel) mit Geburtsschwierigkeiten, Gebissanomalien, offenen

Fontanellen (Schädelknochenlücken) etc. bis hin zu eigentlichen Riesenhunden (beispielsweise Deutsche Doggen, Bernhardiner, Mastiffs oder Irish Wolfhounds) mit teilweise erheblichen Gelenk- und Skelettschäden.
Die Zuchtziele richten sich aber nicht nur nach der Grösse der Tiere. Beispiele für weitere problematische Zuchtformen sind Shar-Peis mit ihrer zu chronischen Entzündungen führenden extremen Hautfaltenbildung, weitgehend zahnlose Nackthunde mit hoher Welpensterblichkeit, auf Kurzköpfigkeit (sogenannte Brachyzephalie) gezüchtete Rassen wie Boxer, Möpse oder Pekinesen, die unter Atemnot, Augenproblemen und weiteren zuchtbedingten Beschwerden leiden und derart massige Schädel aufweisen, dass ein normaler Geburtsvorgang oft verunmöglicht wird. Zudem unterliegen diese Tiere einem erhöhten Hitzeschlagrisiko, weil sie ihre Körpertemperatur nicht genügend durch Hecheln regulieren können.
Darüber hinaus gibt es rasseübergreifende zuchtbedingte Probleme wie beispielsweise Allergien, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen und Herz-Kreilslauferkrankungen, die oft nicht sofort erkennbar sind. Dennoch können sie zu massivem Tierleid führen und Verhaltensänderungen verursachen. Ausserdem ziehen sie oft komplexe Diagnoseverfahren sowie langwierige Behandlungen nach sich, die mit hohen Kosten verbunden sind.
Hände weg von Qualzuchten
Ungeachtet des Qualzuchtverbots werden in der Praxis also weiterhin Hunde mit tierschutzwidrigen Merkmalen gezüchtet. Neben dem Auftrag an die zuständigen Vollzugsinstanzen, fehlbare Züchter konsequent strafrechtlich zu verfolgen, sind auch Zuchtverbände und Veranstalter in der Pflicht, entsprechende Tiere konsequent von Ausstellungen und Wettbewerben auszuschliessen. Und nicht zuletzt stehen natürlich die Konsumenten in der Verantwortung, unseriöse Zuchten, insbesondere auch solche aus dem Ausland, nicht zu unterstützen. Denn auch der Import von Qualzuchten ist leider noch immer nicht verboten. Vor dem Kauf eines Hundes sollte sich daher unbedingt vergewissert werden, ob die Zucht tierschutzkonform erfolgt oder ob ohnehin nicht lieber einem Hund aus dem Tierheim ein neues Zuhause gegeben werden kann.
Dieser Beitrag wurde von Gieri Bolliger und Bianca Körner von der Stiftung für das Tier im Recht (TIR) geschrieben. Hundeherzlichen Dank!